Expertentipps
Erfolgreich Geld anlegen, Steuern reduzieren und die Altersvorsorge optimieren: Lesen Sie unsere Tipps
Für Stiftungen wird es immer schwieriger, Rendite, Kapitalsicherheit und ausreichende Ausschüttungen unter einen Hut zu bringen. Darum holen sich immer mehr gemeinnützige Stiftungen Unterstützung durch professionelle Vermögensverwalter. Vorstände und Stiftungsgründer lassen sich zu wichtigen Fragen und Themen beraten – von der Anlagestrategie bis zur Haftungsreduzierung. Das lohnt sich für mittelgroße wie auch für kleine Stiftungen mit weniger als einer Million Stiftungskapital.
Das bietet Ihnen das VZ VermögensZentrum:

Strategien kombinieren, um das Kapital langfristig zu erhalten – wir helfen dabei.
Albert Bitter
Funktion Anlageexperte
Kostenfreie Anlagetipps von unseren Experten – immer mittwochs in Ihrem Postfach.
Viermal in fünf Jahren ausgezeichnet als bester Vermögensverwalter

Das VZ VermögensZentrum erhält das Siegel Trusted Wealth Manager 2025
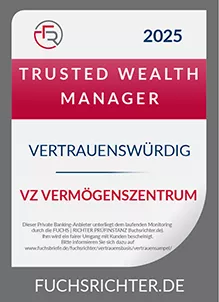
Die Gesellschaft für Qualitätsprüfung bescheinigt dem VZ exzellente Beratungsqualität
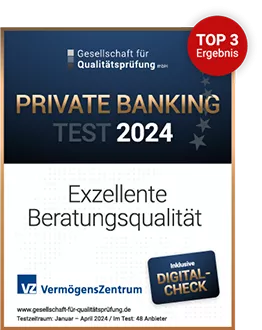
Zum fünften Mal in Folge erhält das VZ die Auszeichung – 2025 erneut als Branchensieger
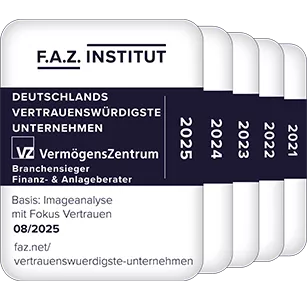
Im Test von Focus Money und n-tv überzeugte das VZ durch seine Beratung und Anlagestrategie.

Factsheet

Merkblatt

Merkblatt

Factsheet

Merkblatt

Maximiliansplatz 12 (Hauptsitz)
Kurfürstendamm 63
Benrather Straße 12
Taunusanlage 17
Tumringer Straße 191
Königstraße 39
Haben Sie zu wenig Erfahrung, Know-how und Zeit für Ihre Geldanlagen? Mit dieser Checkliste finden Sie den passenden Vermögensverwalter.